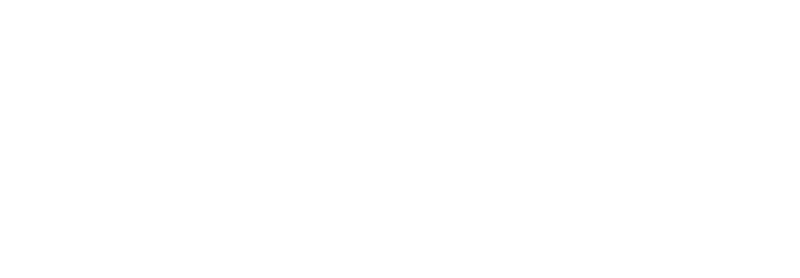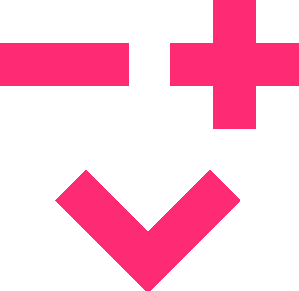Von Mike Sandbothe: Ein Blick in die Bildungsprogramme von acht Parteien zur Bundestagswahl 2025 //
Von Mike Sandbothe: Ein Blick in die Bildungsprogramme von acht Parteien zur Bundestagswahl 2025 //
In den achtziger Jahren habe ich an der Freien Universität in Berlin Philosophie studiert. Einer meiner Professoren war der Hegel- und Kierkegaard-Experte Michael Theunissen. Über mehrere Semester hinweg nahm ich an seinen Vorlesungen zur „Philosophie der Zeit“ teil. Das war ein spannendes work in progress. Frisch gedachtes Denken auf höchstem Niveau. Für jede einzelne Vorlesung hat er sich immer intensiv vorbereitet und viel Fachliteratur gelesen. Manchmal eröffnete er die Vorlesung sichtbar erschöpft und spürbar enttäuscht mit dem Statement: „Das Lesen der Literatur war in dieser Woche wie das Ausdrücken von trockenen Zitronen. Es kam kaum etwas Brauchbares dabei heraus!“ Dieser Satz kam mir in den Sinn, als ich die bildungspolitischen Passagen in den Wahlprogrammen der Parteien zur Bundestagswahl 2025 gelesen habe.
Ich habe acht Zitronen ausgepresst. Die meisten waren ziemlich ausgetrocknet. Nur eine war für meine Wahrnehmung frisch und relativ saftig. Ich gehe mal alphabetisch vor:
AfD
Die AfD fordert Mut zur Leistung, kleinere Klassen und die Umwandlung der Schul- in eine Bildungspflicht. Sie will die Förderschulen erhalten, Online-Unterricht möglichst vermeiden und die Lehrer zur Neutralität verpflichten. An den Hochschulen möchte sie die alten Diplom- und Magisterstudiengänge wieder einführen. Modularisierung, Akkreditierungsverfahren und Gleichstellungsbeauftrage sollen abgeschafft werden. Das Promotionsrecht bleibt den Universitäten vorbehalten und „die zunehmende Einflussnahme ‚woker‘ Ideologie auf die Universitäten“ sowie die „Finanzierung der unwissenschaftlichen Genderforschung ist einzustellen.“ (S. 163)
BSW
Das BSW fordert „eine umfassende Erneuerung der Bildungspolitik“ (S. 24). Das Kooperationsverbot im Bildungsbereich zwischen Bund und Ländern wird abgeschafft, die unterschiedlichen Schultypen bleiben erhalten. Es gibt „einen verpflichtenden Deutschtest für Kinder ab 3 Jahren“ (S. 24), Handys und Tablets werden bis zum Ende der Grundschule aus den Klassenzimmern verbannt und auch danach möglichst wenig im Unterricht eingesetzt. „Der Bund soll für alle Kinder das erste Jahr im Sportverein bezahlen.“ (S. 24) Die „Notengebung als Standard der Leistungsmessung“ (S. 24) und die „Rückorientierung auf verbindliche Lehrinhalte“ (S. 25) werden für alle Schulen gefordert. Für die Hochschulen wünscht sich das BSW eine BaföG-Reform, einen Hochschulsozialpakt, die Wiederherstellung der Wissenschaftsfreiheit und für den Mittelbau „Dauerstellen für Daueraufgaben“ (S. 25).
CDU
Von der CDU bekommen „Kinder unabhängig von Herkunft und Geldbeutel die Chance, das Beste aus sich herauszuholen“ (S. 63). Sie plant einen „Bildungsföderalismus auf der Höhe der Zeit“ (S. 63), ein „bundesweites Bildungsverlaufsregister (S. 64) und eine „ländergemeinsame datenschutzkonforme Identifikationsnummer für alle Schülerinnen und Schüler“ (S. 64). Kritisches Denken, Kreativität, Kommunikation und Kollaboration sollen gefördert werden. Das Wissenschaftssystem wird „zukunftsfest“ aufgestellt: Hochschulen für angewandte Wissenschaften werden durch ein eigenes Programm gefördert und „Einschränkungen für militärische Forschung“ (S. 66) aufgehoben.
FDP
Die FDP zielt auf „weltbeste Bildung für selbstbewusste Bürger“ durch einen „echten Paradigmenwechsel in unserem Bildungssystem“ (S. 6). Sie will „die Kultusministerkonferenz (KMK) als Entscheidungsgremium abschaffen und durch einen Bundesbildungsrat aus Wissenschaftlern, Praktikern, Eltern- und Wirtschaftsvertretern ersetzen.“ (S. 7) KI-gestützte und adaptive Lernmethoden sollen in den Schulalltag integriert werden und „Notenpflicht spätestens ab der dritten Klasse“ (S. 7). In den Hochschulen sorgt „ein technologieoffenes Forschungsfreiheitsgesetz“ dafür, dass wir in Deutschland „durch exzellente Fusionsforschung die Voraussetzungen für den Bau von Fusionskraftwerken schaffen“ (S. 9). Hinzu kommt „eine agile Verteidigungsforschungsanstalt nach amerikanischem Vorbild, die sich auf den Technologietransfer zwischen Militär und Wissenschaft (…) konzentriert“ (S. 10).
Die GRÜNEN
Für die Grünen ist Deutschland faktisch ein Einwanderungsland: „daher braucht es mehr als provisorische und temporäre Lösungen für den Umgang mit Geflüchteten und anderen, die kurzfristig zu uns kommen“ (S. 76). Dazu gehören multiprofessionelle Teams und „diskriminierungssensibles Lernen“ (S. 76). Hinzukommen „politische Bildung, Demokratiebildung, Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung“ sowie ein „verantwortlicher Einsatz von Künstlicher Intelligenz“ (S. 77). Wie das BSW wollen auch die Grünen das Kooperationsverbot abschaffen und in den Hochschulen „Daueraufgaben auf Dauerstellen“ erfüllen lassen. Der „Verächtlichmachung ganzer Forschungsfelder wie etwa der Klima- oder Geschlechterforschung“ treten die Grünen „entschieden entgegen“. Darüber hinaus fordern sie für das Hochschulsystem „moderne Governance- und Personalstrukturen“ (S. 80).
Die LINKE
Die LINKE plant ein „100-Milliarden-Euro-Sondervermögen für die Sanierung, Modernisierung und Unterstützung von Bildungseinrichtungen“ (S. 38). Auch sie will das Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern aufheben. Hausaufgaben werden abgeschafft und das „stark gegliederte deutsche Schulsystem“ wird durch eine „Schule für alle“ und einen „Rechtsanspruch auf ganztägige Bildung“ (S. 39) ersetzt. Um individuelle Förderung zu ermöglichen, braucht es „mehr Pädagog*innen pro Klasse“ und „multiprofessionelle Teams von Lehrkräften, Schulsozialarbeiter*innen, Psycholog*innen und medizinischem Fachpersonal“ (S. 39). Die Mitbestimmungsrechte von Schüler*innen sollen ausgebaut und Werbung der Bundeswehr in Schulen und Universitäten verboten werden. In den Hochschulen setzt die LINKE auf „wirkmächtige demokratisch verfasste Studierendenschaften“ (S. 40) und „ein kooperatives Lern- und Forschungssystem, das gesellschaftliche Schlüsselfragen wie Frieden, soziale Gleichheit und Ökologie ins Zentrum rückt“ (S. 40). An allen Hochschulen und Forschungseinrichtungen sollen Zivilklauseln verankert und Friedensforschung gefördert werden.
SPD
Auch die SPD zielt auf ein neues Bildungssystem für „unsere Einwanderungsgesellschaft“ (S. 16). Sie fordert „multiprofessionelle Teams“ (S. 15) sowie eine „Vielfalt in Bildungsplänen, Schulbüchern und in den pädagogischen Berufen“. Zur Finanzierung will sie „die Erbschafts- und Schenkungssteuer reformieren“ (S. 16). Neben einer Reform des BaföG geht es der SPD in der Hochschulpolitik um „eine Stärkung der Forschungsförderung, insbesondere in der Grundlagenforschung der Schlüsselindustrien und des GreenTech“ (S. 10). An erster Stelle der „Innovationspolitik des Bundes“ steht „die Weiterentwicklung der KI-Strategie“ (S. 9) gefolgt von „Quantencomputing, Robotik sowie Netzwerktechnologien der nächsten Generation“ (S. 10). Außerdem wollen die Sozialdemokraten „den Übergang von der Forschungsidee bis hin zur Marktreife gezielt unterstützen.“ (S. 10)
VOLT
Last but not least ein Blick auf die ebenfalls für den Bundestag zur Wahl stehende Europapartei VOLT. Von ihr wird „projekt- und fächerübergreifender Unterricht (…) als zentraler Bestandteil des Lehrplans gefördert“ (S. 110). Hinzukommen „jahrgangsübergreifendes Lernen“ und „individuelle Lernwege“ (S. 111). Anstelle von Noten werden Portfolios, Lerntagebücher, Präsentationen und Entwicklungsgespräche zur Leistungserfassung genutzt. Kinder und Jugendliche sollen gleichberechtigt in die Bewertungsprozesse einbezogen und die Lern- und Kompetenzziele von Lernenden und Lehrenden gemeinsam definiert werden. Für VOLT steht fest: „Gesundheit und Wohlbefinden sind die Grundlage für erfolgreiches Lernen.“ Deshalb stärken „regelmäßige Angebote (…) das Wohlbefinden von Lernenden und Lehrenden“ und „neutrale Stellen helfen bei Konflikten im Schulsystem.“ (S. 114)
Demokratiebildung erfolgt in allen Fächern. Klassenräte und basisdemokratische Gremien fördern die aktive Mitbestimmung der Lernenden. Letztere sowie Eltern erhalten Antragsrechte in Schulausschüssen, um aktiv an der Schulentwicklung mitzuwirken (S. 112). Schulungen für Eltern fördern das Verständnis für Chancen und Risiken der Digitalisierung (S. 113). Lehrpläne werden auf die wesentlichen Inhalte reduziert und an den Bedürfnissen der Lernenden ausgerichtet (S. 114). Den eigenständigen Wissenserwerb, digitale und soziale Fähigkeiten sowie Gesundheitsbewusstsein rückt VOLT in den Mittelpunkt. Der OECD-Lernkompass und das UNESCO-Programm „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (BNE 2030) dienen als Leitlinie für moderne und zukunftsorientierte Lehrpläne (S. 114) und Natur dient als Lernraum (S.116).
In den Hochschulen will VOLT die Regelstudienzeit an die tatsächliche Studiendauer anpassen (S. 117), die BaföG-Sätze erhöhen und ein Teilzeit-BaföG einführen. Darüber hinaus soll der akademische Mittelbau gestärkt werden. Es gibt automatische Übergänge von der Promotion in eine Post-Doc-Position und Forschende ab der Post-Doc-Phase erhalten ein pauschales Grundbudget. Davon müssen 50 % jeweils auf andere Forschende verteilt werden, damit innovative Ideen und die Vernetzung innerhalb der Forschungsgemeinschaft gestärkt werden (S.118f).
Frischekriterium
Nun dürfen Sie raten, welche Zitrone aus meiner Sicht die frische ist. Vielleicht empfinden Sie das auch ganz anders als ich. Ein wichtiges Frischekriterium ist für mich der Tiefgang der angestrebten Bildungsreform. Und den messe ich anhand des Grades, inwieweit die jeweilige Tranformationsagenda an die Quellen der Veränderung rührt. Die Strukturen, an denen hin und her geschraubt wird, sind keinesfalls die wahre Quelle der Transformation. Diese ist vielmehr das kollektive Bewusstsein, aus dem heraus Strukturen aufrechterhalten, verändert oder wiederhergestellt werden. Das Geheimnis erfolgreicher Bildungstransformation ist einfach und schwierig zugleich. Es liegt in der Pflege des kulturellen Bodens, aus dem heraus Bildungsprozesse wachsen und gedeihen können.
Um den Ball in der Luft zu halten und philosophisch zu schließen, hier noch ein Zitat aus dem Field of the Future Blog des MIT-Transformationsforschers Otto Scharmer: „Wenn man von ‚sozialen Systemen‘ spricht, bezieht man sich gewöhnlich auf das Beobachtbare und Greifbare (Prozesse, Verfahren, Strukturen, Verhaltensmuster). Was ich aber mit sozialem Boden meine, sind die weniger sichtbaren inneren Bedingungen, das, was unter der Oberfläche liegt, die Qualität des Bewusstseins (Aufmerksamkeit und Absichten) und die Qualität der Beziehungen, die unser Handeln beeinflussen.“
Informationen zum Autor:
Prof. Dr. Mike Sandbothe ist Professor für Kultur und Medien an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena. Zusammen mit seinem Kollegen Reyk Albrecht hat er das Thüringer Modellprojekt Achtsame Hochschulen in der digitalen Gesellschaft (2015-2019) geleitet und die überregionale Kooperationsplattform Achtsame Hochschulen sowie das Bildungsunternehmen Achtsam.Digital gegründet.
www.achtsamehochschulen.de
www.achtsam.digital
www.achtsamkeiten.com
www.sandbothe.com
www.lea.education/socialpresencingtheater